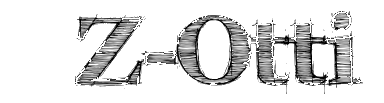So lange haben wir uns drauf gefreut, haben darauf hin gefiebert. Dreimal, zweimal, einmal werden wir noch wach.
Dann war er da, der Freitag der 18.01.2019. – Es hat geschneit!
Ach ja, und Aufbautag der großen Modellbahnausstellung der Eisenbahnfreunde Bad Schwartau war natürlich auch.

Teppich verlegen
Zum Glück gab es nur wenig Schnee, und die Anreise der Teilnehmer war kein Problem. Fast alle Aussteller waren viel zu früh eingetroffen. Das setzte uns bei den Vorbereitungen der Hallen unter Druck. Denn aus der Mensa mussten Stühle und Tische raus, in der kompletten Sporthalle musste der Boden durch einen Teppich geschützt werden. Bei der großen Fläche dauert das Verlegen schon ein wenig. Nach diesen Vorbereitungen mussten die Parzellen eingezeichnet werden – alles mit freudig ungeduldigen Ausstellern im Nacken.
Aber diese Hürde wurde Dank der Hilfe aller Vereinsmitglieder und auch von Seiten der Aussteller schnell gemeistert.
Der Aufbau ging bei allen gut vonstatten, sogar unsere H0e Anlage in der Mensa war um 21 Uhr fertig.
Daniel konnte seine Stockelsdorf-Anlage erst am Samstag aufbauen, er brauchte den Freitag noch für letzte Arbeiten mit dem Begraser an seinem Haltepunktnachbau. Die Anlage war noch nicht durchgetrocknet, als sie Samstag in die Mensa kam.
Die größte Anlage war die der Lübecker Modellbahn Freunde (LMF), sie reichte fast einmal quer durch die ganze Turnhalle. Thorsten hatte alles gut im Griff, seine Truppe war erstaunlich schnell beim Aufbau.
Lediglich bei der Gruppe aus Hannover mit ihrer großen Spur N-Anlage qualmten die Köpfe. Irgendwas bei der Elektrik hakte. Wie ich später erfuhr, ist das bei ihnen aber Standard. 🙂
In der Krummlandhalle, dem Ort der Z-Convention, lief alles wie am Schnürchen. Auch am elektrischen Schnürchen. Fast … Für die “Insel” in der Mitte der Halle zapfte ich den Strom von einer Gitterbrücke an der Hallendecke, nur um Später vom Hausmeister zu erfahren, dass er die nicht einschalten wird, und ich noch weiter nach oben an eine andere Steckdose müsse. Bei einem Test lieferte die auch keinen Saft 😯 .
Abhilfe kam dann vom Hausmeister, der die Sicherung fand und einschaltete.
Die Anlagendichte war hier besonders hoch. Von der kleinsten Kofferanlage bis zur 8 Meter langen Modulanlage, vom vorbildgenauen Nachbau bis zum Mini-Fantasiekreis war alles vertreten.
An anderer Stelle waren die Händler und Börsianer mit dem Standaufbau beschäftigt, so sah es in allen Hallen, Gängen und Umkleideräumen aus wie in einem Ameisenhaufen.
Eberhard war in der Stadt unterwegs, um Wegweiser aufzuhängen. Man sollte möglichst aus allen Richtungen den Weg zu uns gut finden.
Die Versorgung der Aussteller lag uns von Anfang an am Herzen, daher boten wir zur Stärkung Erbsen- und/oder Gulaschsuppe und Kaffee gratis an. Einige hatten Anreisen bis um die 600 Kilometer hinter sich oder kamen sogar aus Dänemark.
Für den Abend hatte ich einen Tisch beim Griechen reserviert, damit sich alle schon einmal beschnuppern und miteinander fachsimpeln konnten. Erfreulicherweise wurde dieses Angebot gut von Börsianern und ideellen Ausstellern angenommen. Alle waren ein wenig erschöpft, und gegen 23 Uhr leerten sich dann die Reihen.
Bilder vom Freitag:

Ralf Spur N beim Aufbau

Die große H0 Modulanlage der LMF

Spur N aus Hannover

Andreas der Börsianer

Sven beim Aufbau von Buntekuh

Aufbau Buntekuh

Spur Z -Buntekuh

Hans Heinz Detail

Hans Heinz Brettchen-Anlage

Jan zapft Kaffee

Ausräumen und Aufbau in der Mensa

Ausladen der H0e Anlage

Aufbau der H0e Anlage in der Mensa

Z Domizil -> Krummland-Halle

Himmelsleiter für den Strom

Spaß bei der Arbeit

Aufbau Mensa

Jugendanlage

Vereins-Infostand

Erster!

Peter und Birgit beim Aufbau

Schildbürger

Edmonsonsche Eintrittskarte

Durchsage
Samstag machte Jan um 8:00 Uhr den Anfang und ließ die Aussteller und Börsianer in die Räumlichkeiten. Einige wenige erledigten erst heute den kompletten Aufbau und hatten die Zeit im Nacken. Ab 9:30 Uhr wurde alles verrammelt, sonst hätten sich schon die ersten Besucher unter die Aussteller gemischt.
Jan und Nicole schmierten in der Küche im Akkord Brötchen und kochten den ersten Kaffee. Merke: Aussteller sind immer hungrig und durstig! 😉
Ehe die Tore geöffnet wurden, gab es eine durch die Tüte geflüsterte Begrüßung aller Teilnehmer. Dann ging’s los – mit Karacho! Wie erwartet, standen die ersten schon 30 Minuten vor offizieller Öffnungszeit am Eingang und warteten in der Kälte auf das freudige Ereignis der Ausstellung.

Küchencrew
Gleich nach dem Einlass um 10:00 Uhr wurde es voll in den Hallen.
Wir hatten aus den Erfahrungen der Vorjahre gelernt, dachten wir, und gleich mehr Lebensmittel für die Mensa besorgt. Aber denkste, wir mussten viermal los und die Vorräte aufstocken, weil am ersten Tag schon so viel gefuttert wurde, wie sonst insgesamt.
Erwähnenswert ist noch der hohe Anteil von Anlagen, an denen die Besucher zum Mitmachen aufgefordert wurden. Bei den Zettlern alleine drei Anlagen, aber auch an der großen H0-Anlage der LMF und bei Hannelore war Mitarbeit erwünscht!

Verkaufsleiterin

Messewagen
Nicht vergessen darf ich natürlich, dass es wieder einen speziellen Sonderwagen gab. Franzi war die Verkaufsleiterin und hat sich ganz toll um die Gestaltung des Verkaufsplatzes gekümmert. Ich war absolut überrascht, da sie alles in Eigenregie geplant und umgesetzt hatte. Okay, mit der Hilfe von Sven, zu der sie ihn total freiwillig verpflichtet hat 🙂
Für den Abend hatte ich ein ganzes Restaurant nur für uns Modellbahnverrückte reserviert. Auch Gäste waren willkommen. Es gab warmes und kaltes Buffet zu fairen Konditionen. Über 60 Personen hatten das Angebot angenommen!
Bilder vom Samstag:

Das freundliche Kassenteam

Verkauf einer Z Sammlung

Börsianer und Figurenmaler

Hanno

Ralf

Daniel mit Stockelsdorf

Haltestelle der Straßenbahner aus Kiel

LMF

Nur H0 ist langweilig!

Schienenputzer

Sporthalle Überblick

Sporthalle und Börsianer

Horst und Hannelore

Aspen /Bahls

Komi

Archistories

Peter und Birgits Module

Hans Heinz

Hans Heinz mit Besucher

Klütz

Jürgen mit Flagstone

Kinderanlage

Jörg Erkel

Wolf Ullrich Malms Buntekuh

Niels an der 8m

langen Modulanlage

Z Lights

Lötvorführung bei Torsten

Rainer und Dammtor

Ralf mit Nordenham

Mitmachanlage bei Hannelore

Straßenbahn-freunde Kiel

Kai und die Mit …

…machanlage
Sonntag Jan hatte wieder in der Küche den größten zeitlichen Vorlauf, um dort mit dem Helferteam alles vorzubereiten.
Um 10:00 Uhr wieder das gleiche Szenario an den Eingängen.
Leider gab es einen unschönen Zwischenfall am Eingang. Eine Mutter mit Kinderwagen fuhr einem Besucher, der in beiden Händen einen Modulkasten trug, in die Beine, sodass er stürzte. Dabei zog er sich einen Miniskusanriss und Rippenbrüche zu. Kommentar der Frau: “Können Sie nicht aufpassen?” Ohne Worte!
Glücklicherweise war das das einzig Negative, was es zu berichten gibt. Wieder gab es begeisterte Aussteller und Gäste, wieder waren die Hallen voll, wieder wurden Getränke, Würstchen und auch die von Mitgliedern und deren Angehörigen fleißig gebackenen Kuchen in großer Menge gekauft, sodass es schon vor 16 Uhr hieß: Ausverkauft!
Auch der Abbau und das Saubermachen gingen reibungslos und fix über die Bühne. Hier kann man nie genug helfende Hände haben, aber der eine oder andere war nach drei ausgefüllten Tage dann doch zu erschöpft. Trotzdem konnten wir exakt um 19:04 Uhr die Hallen abschließen. Mit einem lachenden, einem kleinen weinenden Auge und der Vorfreude auf ein nächstes Mal!
Abends trafen wir uns zum Absacker in einem Steakhaus, auch hier hatte ich vorsichtshalber reserviert.
In netter Atmosphäre bei lecker Essen resümierten wir in Ruhe über die Ausstellung . So lange hatten wir darauf hin gefiebert, schon war es wieder vorbei. Zeit, sich ein bisschen zu erholen und …
Bilder vom Sonntag:

Archistories

Mensa H0e EFS

Blick in die Küche

Fried an der Jugendanlage

HEL Infostand

Ralf mit der Spur N Anlage

Nordenham

Nordenham

Die Kieler Straßenbahn-freunde

Blick in die Sporthalle

Jordberg-kirche Z

Thomas mit Kleinanlage

Manfred mit der …

Schweine-anlage
… ein Fazit zu ziehen:
2.046 Besucher! Ohne Kinder unter 6 Jahren, da sie freien Eintritt hatten und deshalb nicht gezählt wurden.
Es hat uns wieder einmal viel Spaß und Freude bereitet, als Gastgeber zu fungieren. Die Rückmeldungen während der Ausstellung und auch noch danach waren einfach super! Deshalb haben wir uns bei der Stadt gleich einen Termin für Januar 2021 gesichert! 😎
Für die Unterstützung und den Ansporn allen Aktiven ein dickes fettes Dankeschön!
Die Presse hat uns toll begleitet. Die Lübecker Nachrichten veröffentlichten am Mittwoch und am Freitag einen Vorbericht, Samstag gab es einen ausführlichen Bericht zur Ausstellung in der Print- und der Online-Ausgabe.
Am Mittwoch der Folgewoche gab es einen großen Nachbericht, leider nur in gedruckter Form.
Ein Kommentar des netten Reporters: “Wir können daraus doch keine Sonderbeilage machen.” 😎
Tja, warum eigentlich nicht 😉
Beim Radiosender NDR2 gab es einen Veranstaltungshinweis und RSH (Radio Schleswig-Holstein) hat ein kurzes Interview gesendet.
Im TV wurde im Schleswig-Holstein-Magazin, bei den Veranstaltungshinweisen, auf uns hingewiesen. Viel mehr geht nicht.
Sonderwagen in der Spur Z:
 Einen Dank möchte ich an die Lübecker Maschinenbau Gesellschaft für die Freigabe des Logos auf dem Sonderwagen aussprechen.
Einen Dank möchte ich an die Lübecker Maschinenbau Gesellschaft für die Freigabe des Logos auf dem Sonderwagen aussprechen.
Damit konnten wir einen überzeugenden Wagen bei Märklin in Auftrag geben, der einen großen Bezug zur Region darstellt. Einer unserer Vereinsmitglieder hat dort sogar seine Ausbildung absolviert.
LMG bei Wikipedia
LMG Firmengeschichte
Links:
Messenachlese bei den Eisenbahnfreunden Bad Schwartau
Ausstellerliste und Vorankündigung
Messenachlese beim Freundeskreis der Spur Z Hamburg
Berichte in den Lübecker Nachrichten
- Vorbericht Dienstag
- Vorbericht Freitag
- Bericht Samstag
- Nachbericht am folgenden Mittwoch leider nicht online verfügbar
Vorbericht der Szene Lübeck
Besuchervideo von Ralf
 Diese kleine Dose erhielt ich schon 2012 von einer netten Dame aus Halle an der Saale.
Diese kleine Dose erhielt ich schon 2012 von einer netten Dame aus Halle an der Saale. Es war nicht so ganz einfach, diese tolle Szenerie umzusiedeln ohne etwas zu zerstören, aber es ist mir zum Glück gelungen.
Es war nicht so ganz einfach, diese tolle Szenerie umzusiedeln ohne etwas zu zerstören, aber es ist mir zum Glück gelungen.![]()
 Eine noch kleinere Dose erhielt ich von Kai W. auf einem der bei mir veranstalteten
Eine noch kleinere Dose erhielt ich von Kai W. auf einem der bei mir veranstalteten Das Rätsel ist schnell gelöst. 😎
Das Rätsel ist schnell gelöst. 😎 Damit die Szene auf mein Modul passt, musste ein bereits angelegtes Grundstück weichen.
Damit die Szene auf mein Modul passt, musste ein bereits angelegtes Grundstück weichen. Die Szene war in der Dose auf einem dünnen Holzbrettchen montiert. Also konnte ich alles in einem Stück aus der Dose entfernen. Prima. Das Minibrettchen habe ich etwas zurecht geschnitten, damit es perfekt an den vorbereiteten Platz passt. Die Mauer demontierte ich vorher, um sie nicht zu beschädigen. Später soll sie das Grundstück vor neugierigen Blicken abschotten.
Die Szene war in der Dose auf einem dünnen Holzbrettchen montiert. Also konnte ich alles in einem Stück aus der Dose entfernen. Prima. Das Minibrettchen habe ich etwas zurecht geschnitten, damit es perfekt an den vorbereiteten Platz passt. Die Mauer demontierte ich vorher, um sie nicht zu beschädigen. Später soll sie das Grundstück vor neugierigen Blicken abschotten. Hier ist nun alles an seinem Platz.
Hier ist nun alles an seinem Platz.![]()